Der Betriebsfortführungsvertrag - Ein Mittel
Ein Betriebsübergang findet statt, wenn ein Betrieb unter Wahrung seiner wirtschaftlichen Einheit an einem anderen Unternehmer veräußert wird. Was zunächst simple erscheint ist in der Praxis deutlich komplizierter. Der 8. Senat hatte Anfang der Jahres 2018 erneut über die Voraussetzungen eines Betriebsübergangs zu entscheiden. Zur Frage stand, ob der zwischen dem Veräußerer und Erwerber geschlossene Betriebsführungsvertrag, den für einen Betriebsübergang notwendigen Inhaberwechel herbeiführt. Das Bundesarbeitsgericht verneinte dies.
Dirk Streifler - Anwalt für Arbeitsrecht - Streifler & Kollegen
Was ist ein Betriebsführungsvertrag
Ein Betriebsführungsvertrag wird immer dann aufgesetzt wenn eine Gesellschaft (Eigentümergesellschaft) ein anderes Unternehmen beauftragt das Unternehmen für ihre Rechnung zu führen.
Echter Betriebsführungsvertrag
Bei einem echte Betriebsführung agiert der Betriebsführer in Vertretung und in fremden Namen der Eigentümergesellschaft.
Unechter Betriebsführungsvertrag
Bei unechter Betriebsführung handelt die Betriebsführungsgesellschaft hingegen in eigenem Namen. Sie wird nach außen selbst sowohl rechtsgeschäftlich verpflichtet als auch berechtigt.
Vorteile eines Betriebsführungsvertrages
Zunächst einmal kann ein Betriebsführungsvertrag ein Mittel zur Restrukturierung darstellen. Hieraus ergeben sich steuerliche Vorteile.
Ein Betriebsführungsvertrag lohnt ich auch aus arbeitsrechtlicher Sicht. Findet eine Umstrukturierung unter einem unechten Betriebsführungsvertrag statt, werden die Arbeitnehmer der Betreibenden Gesellschaft zugerechnet. Dadurch können sich diese, einzig auf das Vermögen der betreibenden Gesellschaft berufen. Dieses Vermögen wird in den meisten Fällen geringer sein. In Hinblick auf Sozialplanansprüche in Verbindung mit einer Betriebsänderung i.S.d. §§ 111 ff. BetrVG können die Restrukturierungskosten hierdurch deutlich gesenkt werden.
Sachverhalt
Die Parteien streiten über das Fortbestehen eines Arbeitsvertrages. Der Beklagte meint, ein Arbeitsverhältnis bestehe mit dem bisherigen Arbeitgeber fort, während die Klägerin der Ansicht ist dieses sei infolge eines Betriebsübergangs, auf die neu gegründete Gesellschaft, übergangen. Der Beklagte war seit 1976 als Schlosser im Betrieb der Klägerin, in Berlin angestellt. Im März 2011 wurde von der Klägerin und der Gesellschaft eine „Vereinbarung über Lohnfertigung und Geschäftsbesorgungsvertrag über Betriebsführung“ abgeschlossen. Danach sollte die neu gegründete Gesellschaft ab dem 1. April 2011 die gesamte Produktion der Klägerin an allen Standorten (Berlin, Oberstenfeld, Niederorschel) übernehmen. Weiterhin war geregelt, dass die Betriebsführungsgesellschaft ausschließlich für Rechnung und im Namen des Arbeitgebers tätig wird. Insoweit wurde ihr eine Generalvollmacht erteilt. Sie erfüllte seit dem typische Arbeitgeberpflichten – errichtete Steuern und Sozialversicherungsverträge.
Im Jahr 2013 wurden, mit der Liquidation der Gesellschaft, alle drei Betriebe stillgelegt.
Alle Arbeitnehmer, auch dem Beklagten, wurden unterrichtet, dass mit Ablauf der 31. März 2011 ihre Arbeitverhältnisse, infolge eines Betriebsübergangs auf die Gesellschaft übergehen. Ende März 2014 kündigte die Gesellschaft das Arbeitsverhältnis mit dem Beklagten wegen Stilllegung des Betriebs.
Die Klägerin meint es bestehe, aufgrund eines Betriebsübergang, seit März 2011 kein Arbeitsverhältnis zwischen ihr und dem Beklagten. Sie erhebt negative Feststellungsklage. Diese ist auf das Nichtbestehen eines Rechtsverhältnissen i.S.v. § 256 Abs. 1 ZPO (Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses) zwischen den Parteien gerichtet.
Vorherigen Instanzen
Das Arbeitsgericht gab der Klage zunächst statt (Urteil vom 18. 11. 2015 – 39 Ca 8638/15). Der Arbeitnehmer ging in Berufung, woraufhin das LAG Berlin Brandenburg (Urteil vom 11.05.2016 – 15 Sa 108/16) die Klage nun abwies. Die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und der Gesellschaft stelle einen echten Betriebsführungsvertrag dar, weil sie gegenüber Kunden und Lieferanten nicht als Betriebsinhaber auftrete, so dass es an einem Inhaberwechsel fehle. Dieser ist Voraussetzung für einen Betriebsübergang – so das LAG.
Auch die Revision des Arbeitgebers hatte keinen Erfolg - mit Urteil vom 25. 01. 2018 entschied der 8. Senat, dass kein Betriebsübergang stattgefunden hat.
Urteil des Bundesarbeitsgerichts: Kein Betriebsübergang
Voraussetzung für einen Betriebsübergang sei, dass die natürliche oder juristische Person, welche in die Arbeitgeberpflichten des bisherigen Unternehmers eintritt, durch Vertrag wechselt. An dieser Voraussetzung fehle es dann, wenn ein Dritter mit Generalvollmacht ausschließlich für dessen Rechnung und in seinem Namen die Produktion weiterführe. Die Klägerin übertrug insoweit nicht die Verantwortung ihres Unternehmens an die Gesellschaft.
Nun steht fest, dass ein Betriebsübergang durch einen echten Betriebsführungsvertrag nicht möglich ist. Hier fehle es bereits an - für die Rechtsfolgen des § 613 a BGB notwendigen - Inhaberwechsel, da die Eigentümergesellschaft in diesem Fall Vertragspartner der Arbeitgeber bleibt. Fraglich ist, ob ein unechter Betriebsführungsvertrag in jedem Fall so ausgelegt werden kann, dass ein Betriebsübergang immer stattfindet.
Haben Sie noch Fragen zum Thema Betriebsfortführungsvertrag? Dann nehmen Sie Kontakt zu Streifler & Kollegen auf und lassen Sie sich fachkundig beraten.
Rechtsanwalt
moreResultsText



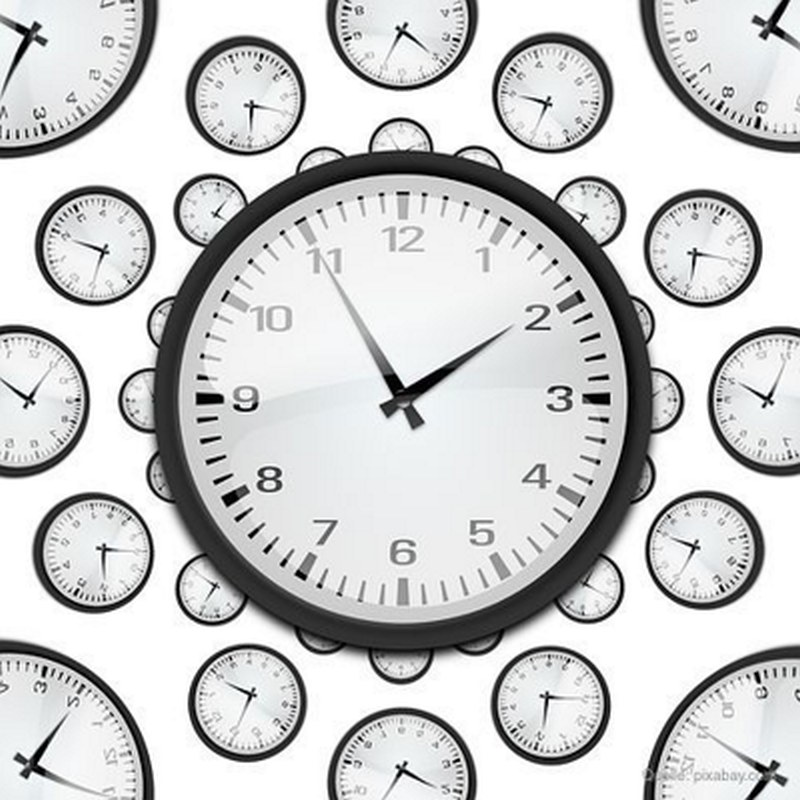
Annotations
(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.
(2) Bis zum Schluss derjenigen mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde.


