§ 300 StGB: Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
published on 09.04.2015 13:09
§ 300 StGB: Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
AoLs
Authors
In besonders schweren Fällen wird eine Tat nach § 299 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn
1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht oder
2. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.
§ 300 StGB enthält für besonders schwere Fälle des § 299 StGB einen erhöhten Strafrahmen vor (drei Monate bis fünf Jahre). Er wurde 1997 durch Art. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes eingeführt. Dabei wurde auf eine Angleichung an die Bestechung im Amt gem. §§ 331ff. StGB verzichtet. Bei der Norm handelt es sich um Regelbeispiele, die sich innerhalb der Strafzumessung strafschärfend auswirken. Liegt eines der in Satz 2 genannten Regelbeispiele vor, so ist die Strafe „in der Regel“ zu schärfen (Indizwirkung). Kommt der Richter nach einer Gesamtwürdigung der Umstände hingegen zu der Überzeugung, dass eine Strafschärfung nicht gerechtfertigt ist, hat er die Möglichkeit von einer solchen abzusehen.
§ 300 S. 2 StGB kennt drei Regelbeispiele:
Vorteil großen Ausmaßes (Nr. 1)
Bezieht sich die Tat aus einen Vorteil großen Ausmaßes, ist das Regelbeispiel gem. § 300 S. 1 Nr. 1 StGB einschlägig. Ein Vorteil großen Ausmaßes liegt vor, wenn dessen Wert den Durchschnittswert der erlangten Vorteile erheblich überschreitet. Das Ausmaß der wettbewerbswidrigen Bevorzugung ist hierbei außer Acht zu lassen. Aufgrund seiner Unbestimmtheit ist eine restriktive Auslegung geboten. Das Regelbeispiel ist dabei tatbestandsspezifisch auszulegen; auf allgemeine Maßstäbe anderer Normen kann aufgrund der unterschiedlichen Schutzzwecke nicht zurückgegriffen werden.
Bei der Bezifferung des Vorteils großen Ausmaßes müssen die materiellen Zuwendungen geeignet sein, den Vorteilnehmer zu korrumpieren. Anhaltspunkte dafür sollen zum einen die in der freien Marktwirtschaft höheren Einkommen sein. Daneben sonst auch sonstige persönliche Verhältnisse des Angestellten/Beauftragten zu berücksichtigen.. In der Literatur beläuft sich die Grenze daher von unter Umständen schon 10.000€ bis hin zu 25.000€ .
Gewerbsmäßiges Handeln oder Handeln als Mitglied einer Bande (Nr. 2)
Gewerbsmäßiges Handelni.S.d. § 300 S. 2 Nr. 2 Var. 1 StGB liegt vor, wenn sich der Täter durch wiederholte Tatbegehung eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer verschaffen will. Hierfür genügt bereits die erste Tatbegehung (vgl. BGH Beschluss v. 19.12.2007 – Az. 5 StR 543/07; BGH Beschluss v. 17.06.2004 – Az. 3 StR 344/03). Das Regelbeispiel kommt häufig zur Anwendung, wenn der Täter sich ein umfangreiches Korruptionssystem aufbaut, aus dem er sich fortlaufend eigene Vorteile verschaffen will.
Der Bandenbegriff ist angelehnt an den des § 244 StGB. Demnach handelt es sich um eine Bande bei einem Zusammenschluss von mindestens drei Personen, die sich mit dem Willen verbunden haben künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbstständige, im Einzelnen noch ungewisse Straftaten des im Gesetz genannten Deliktstyps zu begehen (vgl. BGH Beschluss v. 22.03.2001 – Az. GSSt 1/00). Die Norm umfasst dabei auch Zusammenschlüsse von Vorteilsnehmern und –gebern.
Unbenannte besonders schwere Fälle
Ein unbenannter besonders schwerer Fall kann vorliegen, wenn trotz eines geringen Vorteils der lautere Wettbewerb nachhaltig erschüttert wird. Das kann der Fall sein bei objektiver Schädigung eines Mitbewerbers, bei Untreuehandlungen gegenüber dem Geschäftsherrn oder bei einer Bevorzugung auf erhebliche Vermögenswerte.
1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht oder
2. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.
§ 300 StGB enthält für besonders schwere Fälle des § 299 StGB einen erhöhten Strafrahmen vor (drei Monate bis fünf Jahre). Er wurde 1997 durch Art. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes eingeführt. Dabei wurde auf eine Angleichung an die Bestechung im Amt gem. §§ 331ff. StGB verzichtet. Bei der Norm handelt es sich um Regelbeispiele, die sich innerhalb der Strafzumessung strafschärfend auswirken. Liegt eines der in Satz 2 genannten Regelbeispiele vor, so ist die Strafe „in der Regel“ zu schärfen (Indizwirkung). Kommt der Richter nach einer Gesamtwürdigung der Umstände hingegen zu der Überzeugung, dass eine Strafschärfung nicht gerechtfertigt ist, hat er die Möglichkeit von einer solchen abzusehen.
§ 300 S. 2 StGB kennt drei Regelbeispiele:
Vorteil großen Ausmaßes (Nr. 1)
Bezieht sich die Tat aus einen Vorteil großen Ausmaßes, ist das Regelbeispiel gem. § 300 S. 1 Nr. 1 StGB einschlägig. Ein Vorteil großen Ausmaßes liegt vor, wenn dessen Wert den Durchschnittswert der erlangten Vorteile erheblich überschreitet. Das Ausmaß der wettbewerbswidrigen Bevorzugung ist hierbei außer Acht zu lassen. Aufgrund seiner Unbestimmtheit ist eine restriktive Auslegung geboten. Das Regelbeispiel ist dabei tatbestandsspezifisch auszulegen; auf allgemeine Maßstäbe anderer Normen kann aufgrund der unterschiedlichen Schutzzwecke nicht zurückgegriffen werden.
Bei der Bezifferung des Vorteils großen Ausmaßes müssen die materiellen Zuwendungen geeignet sein, den Vorteilnehmer zu korrumpieren. Anhaltspunkte dafür sollen zum einen die in der freien Marktwirtschaft höheren Einkommen sein. Daneben sonst auch sonstige persönliche Verhältnisse des Angestellten/Beauftragten zu berücksichtigen.. In der Literatur beläuft sich die Grenze daher von unter Umständen schon 10.000€ bis hin zu 25.000€ .
Gewerbsmäßiges Handeln oder Handeln als Mitglied einer Bande (Nr. 2)
Gewerbsmäßiges Handelni.S.d. § 300 S. 2 Nr. 2 Var. 1 StGB liegt vor, wenn sich der Täter durch wiederholte Tatbegehung eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer verschaffen will. Hierfür genügt bereits die erste Tatbegehung (vgl. BGH Beschluss v. 19.12.2007 – Az. 5 StR 543/07; BGH Beschluss v. 17.06.2004 – Az. 3 StR 344/03). Das Regelbeispiel kommt häufig zur Anwendung, wenn der Täter sich ein umfangreiches Korruptionssystem aufbaut, aus dem er sich fortlaufend eigene Vorteile verschaffen will.
Der Bandenbegriff ist angelehnt an den des § 244 StGB. Demnach handelt es sich um eine Bande bei einem Zusammenschluss von mindestens drei Personen, die sich mit dem Willen verbunden haben künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbstständige, im Einzelnen noch ungewisse Straftaten des im Gesetz genannten Deliktstyps zu begehen (vgl. BGH Beschluss v. 22.03.2001 – Az. GSSt 1/00). Die Norm umfasst dabei auch Zusammenschlüsse von Vorteilsnehmern und –gebern.
Unbenannte besonders schwere Fälle
Ein unbenannter besonders schwerer Fall kann vorliegen, wenn trotz eines geringen Vorteils der lautere Wettbewerb nachhaltig erschüttert wird. Das kann der Fall sein bei objektiver Schädigung eines Mitbewerbers, bei Untreuehandlungen gegenüber dem Geschäftsherrn oder bei einer Bevorzugung auf erhebliche Vermögenswerte.
Show what you know!
1 Urteile
{{count_recursive}} Urteile zitieren order werden zitiert von diesem Artikel
{{count_recursive}} Urteile werden in dem Artikel zitiert
published on 19.12.2007 00:00
5 StR 543/07 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS vom 19. Dezember 2007 in der Strafsache gegen wegen Betrugs Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Dezember 2007 beschlossen: 1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgeri
2 Anwälte, die zu passenden Rechtsgebieten beraten

Wirtschaftsrecht / Existenzgründung / Insolvenzrecht / Gesellschaftsrecht / Strafrecht
Areas of lawEuroparecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Maklerrecht, Insolvenzrecht, Sanierung von Unternehmen, Steuerrecht, showMore
Languages
EN, DERechtsanwalt

Die Kanzlei "Streifler & Kollegen" vertritt Sie auch in Angelegenheiten des Film-, Medien- und Urheberrechts.
Languages
EN, FR, Anwälte der Kanzlei die zu Strafrecht beraten
305 Artikel zu passenden Rechtsgebieten
moreResultsText
08.01.2008 19:09
Strafverteidiger in Berlin Mitte - BSP Rechtsanwälte
SubjectsStrafrecht
23.06.2010 11:44
Rechtsanwalt für Wirtschaftsstrafrecht - BSP Bierbach, Streifler & Partner PartGmbB
SubjectsStrafrecht

14.12.2020 14:14
Erlangt eine Privatperson, die auf Veranlassung der Ermittlungsbehörden mit dem Tatverdächtigten ohne Aufdeckung der Ermittlungsabsicht spricht, Informationen zum Untersuchungsgegenstand, dürfen diese verwertet werden, wenn es um die Aufklärung einer Straftat von erheblicher Bedeutung geht sowie die Erforschung des Sachverhalts unter Einsatz anderer Ermittlungsmethoden erheblich weniger erfolgsversprechend oder wesentlich erschwert gewesen wäre – Streifler & Kollegen, Dirk Streifler, Anwalt für Strafrecht
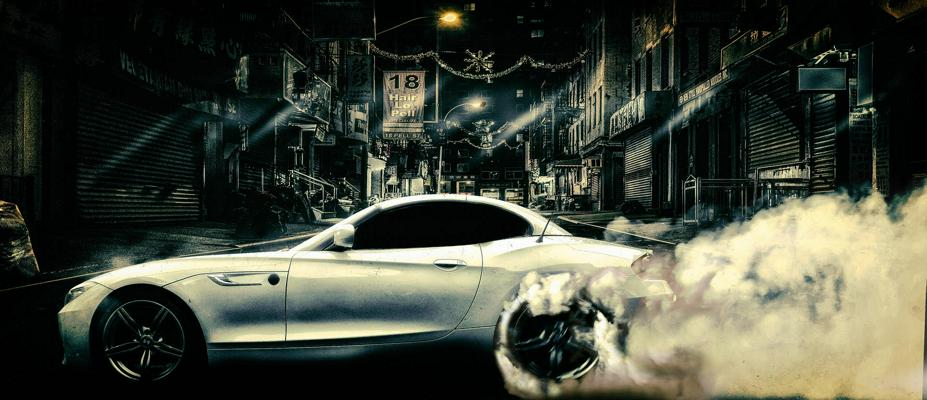
by Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner, Streifler & Kollegen Rechtsanwälte, Rechtsanwalt Film-, Medien- und Urheberrecht, Streifler & Kollegen Rechtsanwälte
31.07.2020 12:31
Autofahrer, die ein illegales Wettrennen im Straßenverkehr mit dem Willen, das Rennen zu obsiegen, durchführen, können sich wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe strafbar machen. Wie ein bedingter Vorsatz in solchen Raserfällen das Mordurteil begründen und damit auch eine Abgrenzung zur fahrlässigen Körperverletzung mit Todesfolge geschaffen werden kann, prüft der 4.Strafsenat im folgendem Urteil (4 StR 482/19) vom 18. Juni 2020. In diesem Artikel lesen Sie, wieso der BGH das Mordurteil des einen Angeklagten bestätigt, das des anderen aber aufhebt und zurück an das Landgericht Berlin verweist. – Streifler & Kollegen – Benedikt Mick, Anwalt für Strafrecht
Artikel zu Strafrecht
Annotations
5 StR 543/07
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom 19. Dezember 2007
in der Strafsache
gegen
wegen Betrugs
Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Dezember 2007
beschlossen:
1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts Chemnitz vom 11. Mai 2007 nach § 349 Abs. 4 StPO im gesamten Strafausspruch mit den zugehörigen Feststellungen aufgehoben.
2. Die weitergehende Revision wird nach § 349 Abs. 2 StPO als unbegründet verworfen.
3. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmittels, an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.
G r ü n d e
2. Die weitergehende Revision wird nach § 349 Abs. 2 StPO als unbegründet verworfen.
3. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmittels, an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.
G r ü n d e
- 1
- Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Betrugs in 18 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die Revision des Angeklagten hat mit der Sachrüge den aus dem Tenor ersichtlichen Teilerfolg. Im Übrigen ist sie aus den Gründen der Antragsschrift des Generalbundesanwalts unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO.
- 2
- 1. Der Senat bemerkt ergänzend zum Schuldspruch:
- 3
- Der Angeklagte hat sich dadurch am fremdnützigen Betrug zugunsten der Firma T. GmbH beteiligt, dass er als Vorstand der T. AG in 18 Einzelfällen den betroffenen Arbeitnehmern dieser Gesellschaft die Aufhebung des bisherigen Arbeitsvertrages nahelegte und zugleich mit der T. GmbH einen Subunternehmervertrag abschloss, mit dem sich die T. GmbH zur Fortführung der Leitschienendemontage verpflichtete und zu dessen Erfüllung dieses Unternehmen das von der T. AG übernommene Personal einsetzte. Dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe ist der mit dem gesondert verfolgten A. , dem faktischen Geschäftsführer der T. GmbH, verabredete Tatplan zu entnehmen, wonach es von vornherein feststand, dass die T. AG nach Verrechnung mit vorgeschobenen Gegenansprüchen die Werklohnforderungen der Subunternehmerin T. GmbH nicht würde bezahlen können und folglich die T. GmbH, die, wie beabsichtigt, im Dezember 2004 insolvent wurde, die Arbeitslöhne nicht würde bezahlen können. Angesichts des nicht unerheblichen Tatbeitrags des Angeklagten und seines Interesses am Taterfolg, das darin bestand, die Arbeitsverhältnisse mit den Angestellten der T. AG ohne Rechtsstreitigkeiten bei gleichzeitiger Fortführung des Werkvertrags mit der Hauptauftraggeberin zu beenden, ist der Schluss des Landgerichts auf mittäterschaftliches Handeln des Angeklagten und nicht lediglich auf Beihilfe revisionsgerichtlich nicht zu beanstanden.
- 4
- 2. Indes wird die Annahme von Gewerbsmäßigkeit durch die Feststellungen nicht belegt. Es ist daher rechtsfehlerhaft, dass das Landgericht die Einzelstrafen nach dem für besonders schwere Fälle des Betrugs vorgesehenen Strafrahmen (§ 263 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 StGB) bestimmt hat.
- 5
- a) Gewerbsmäßig handelt, wer sich durch wiederholte Tatbegehung eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger Dauer verschaffen will (st. Rspr.; BGHR StGB § 263 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Gewerbsmäßig 1 m.w.N.). Gewerbsmäßigkeit setzt daher stets – im Unterschied zu den Voraussetzungen des Betrugstatbestandes – eigennütziges Handeln und damit tätereigene Einnahmen voraus. Betrügerisch erlangte Betriebseinnahmen für den Arbeitgeber reichen daher nur dann aus, wenn diese dem Täter mittelbar – etwa über das Gehalt oder Beteiligung an Betriebsgewinnen – zufließen sollen (BGH NStZ 1998, 622, 623; Stree/Stern- berg-Lieben in Schönke/Schröder, StGB 27. Aufl. 2006 Vorbem. §§ 52 ff. Rdn. 95). Liegt die Eigennützigkeitsabsicht vor, ist bereits die erste Tat als gewerbsmäßig begangen einzustufen, auch wenn es entgegen den ursprünglichen Intentionen des Täters zu weiteren Taten nicht kommt (BGHR aaO). Wenn der Täter nur ein einziges, wenngleich für ihn auskömmliches Betrugsgeschäft plant, fehlt es an der Absicht wiederholter Tatbegehung. Das Merkmal der Gewerbsmäßigkeit wird daher nicht schon dann verwirklicht , wenn die vereinbarte Vergütung für ein einziges Geschäft in Teilbeträgen gezahlt werden soll (BGH, Urteil vom 4. April 1989 – 1 StR 87/89).
- 6
- b) Die vom Landgericht zugrunde gelegten Vorteile entsprechen den genannten Voraussetzungen nicht. Das Landgericht hat bereits dazu keine Feststellungen getroffen, ob der Angeklagte aus den Betrugstaten Einnahmen oder vergleichbare geldwerte Vorteile für sich erzielen wollte:
- 7
- Soweit das Landgericht den wirtschaftlichen Nutzen für den Mittäter A. darin gesehen hat, dass dieser von den Auftraggeberfirmen 8 Euro pro Arbeitnehmerstunde „schwarz“ erhalten sollte, hat es sich nicht von der Beteiligung des Angeklagten an diesen Taterlösen überzeugt (vgl. insbesondere UA S. 23).
- 8
- Sofern das Landgericht einen wirtschaftlichen Vorteil für den Angeklagten deswegen angenommen hat, weil die T. AG den Auftrag von der W. H. V. GmbH über die Subunternehmerfirma weiterführen konnte, ohne als Arbeitgeberin Arbeitslohn zu schulden, sich ohne arbeitsgerichtliche Streitigkeiten von den betroffenen Arbeitnehmern lösen konnte und damit – unter Berücksichtigung der geplanten Verrechnung mit erfundenen Gegenforderungen – die Aussicht auf eine erhebliche Gewinnspanne aus dem Werkvertrag mit der Auftraggeberfirma hatte, genügt dies nicht zur Annahme von Gewerbsmäßigkeit. Denn dies sind Vorteile für die T. AG. Feststellungen dazu, ob die beabsichtigten Gewinne mittelbar dem Angeklagten zugute kommen sollten, insbesondere ob dieser neben einem Festgehalt als Vorstand an den Betriebsgewinnen der AG beteiligt werden sollte, enthält das Urteil nicht. Den Feststellungen ist auch in ihrer Gesamtheit nicht zu entnehmen, dass die T. GmbH überhaupt keine legale Tätigkeit entfaltete und ihre Einnahmen nur aus der rechtswidrigen Vergabe von Subunternehmeraufträgen auf Kosten von deren Arbeitnehmern erzielen sollte.
- 9
- Darüber hinaus ist mangels Feststellungen zu dem Abrechnungsverhältnis zwischen der Auftraggeberin und der T. AG nicht auszuschließen , dass es dem Angeklagten im Tatzeitraum September 2004 bis Dezember 2004 nur um die Abwicklung eines zuvor bereits begonnenen Geschäfts ging. Dann würde es auch an der erforderlichen Wiederholungsabsicht fehlen, zumal das Landgericht in der Beweiswürdigung ausführt, dass es sich bei der Übertragung der Arbeitsverträge auf die Subunternehmerin nur um die Ausnutzung einer sich „kurzfristig bietende[n] Möglichkeit“ (UA S. 28) handelte.
- 10
- c) Der Senat vermag nicht auszuschließen, dass in der neuen Hauptverhandlung Feststellungen dazu, ob an den Angeklagten Gelder geflossen sind, möglich sind. Er hebt daher die Feststellungen, die den Strafausspruch betreffen, insgesamt auf, um umfassende neue Feststellungen zu § 263 Abs. 3 StGB zu ermöglichen.
